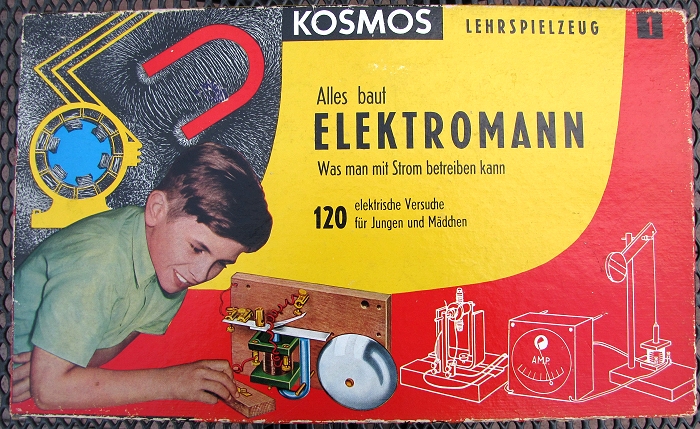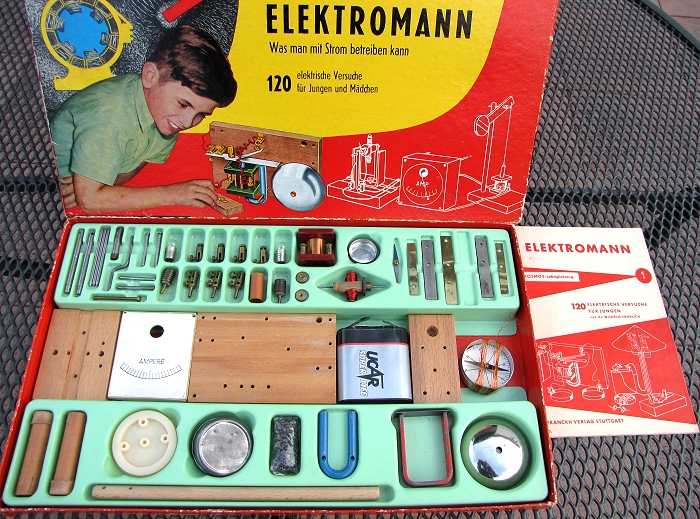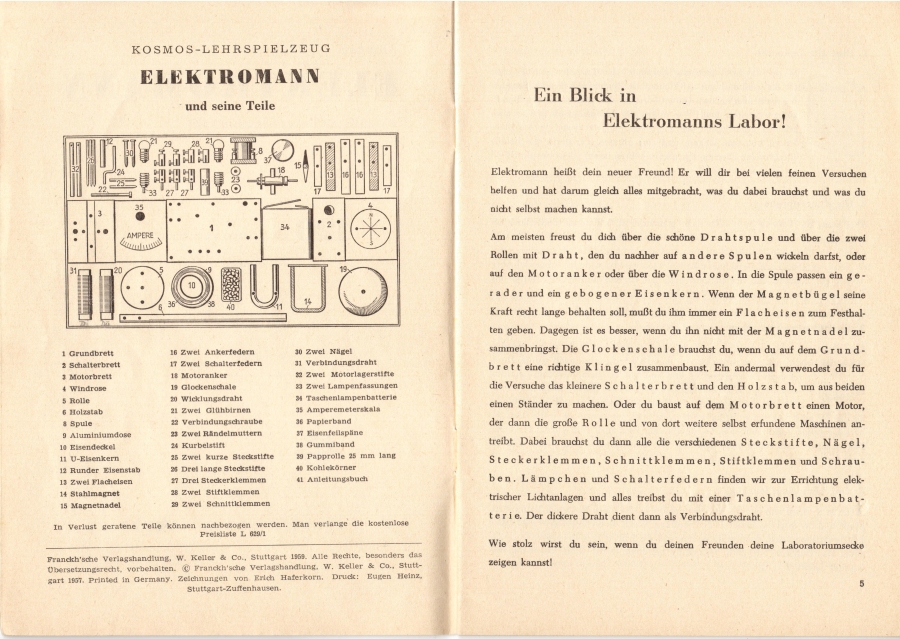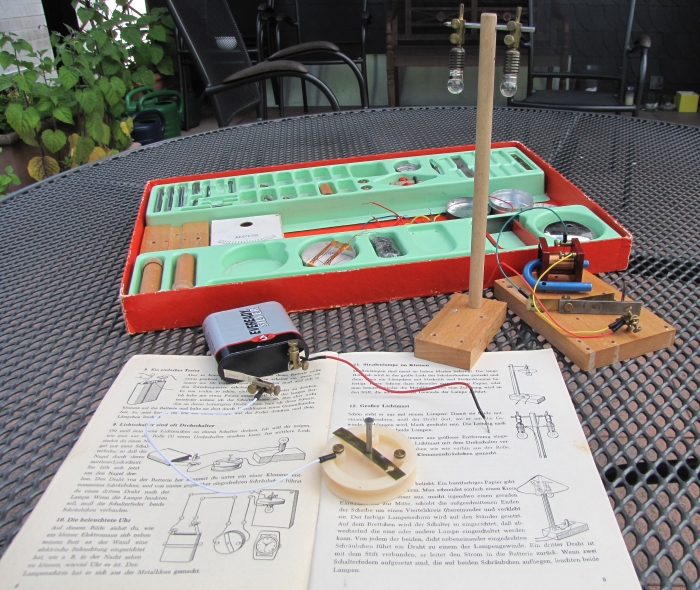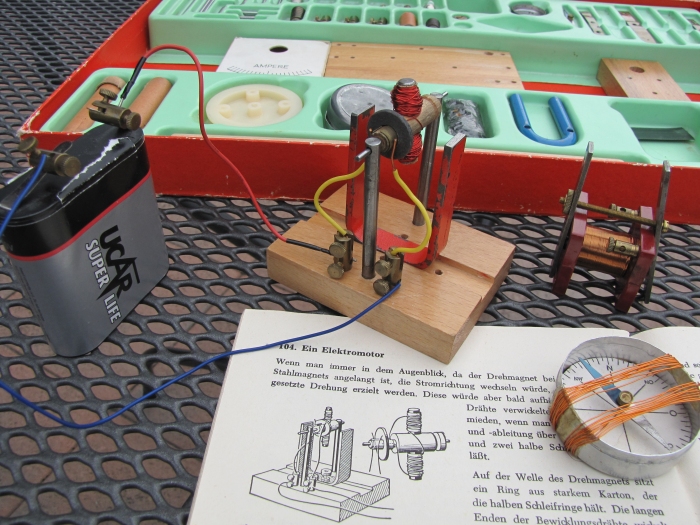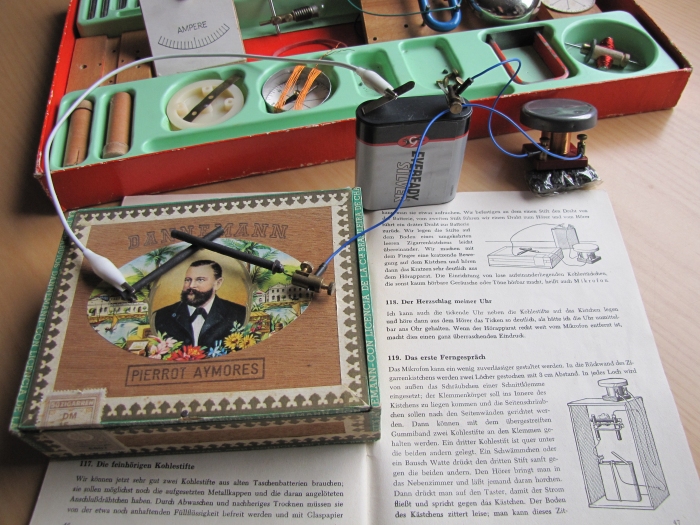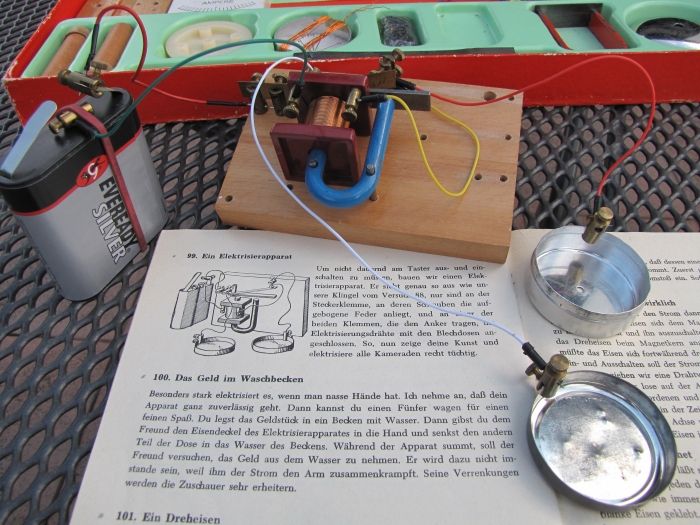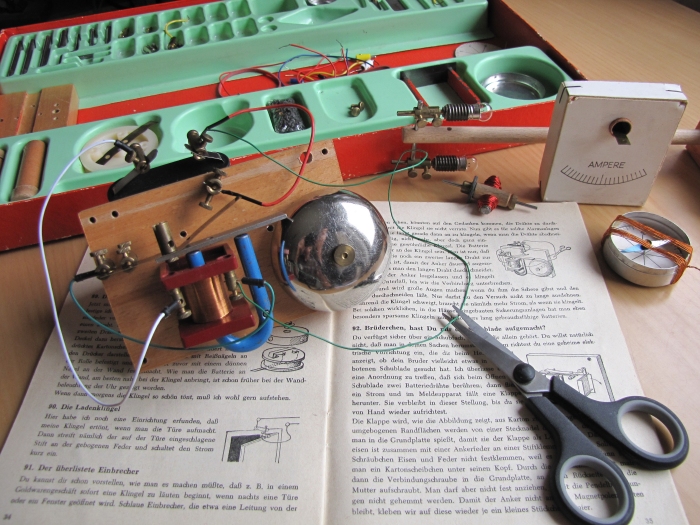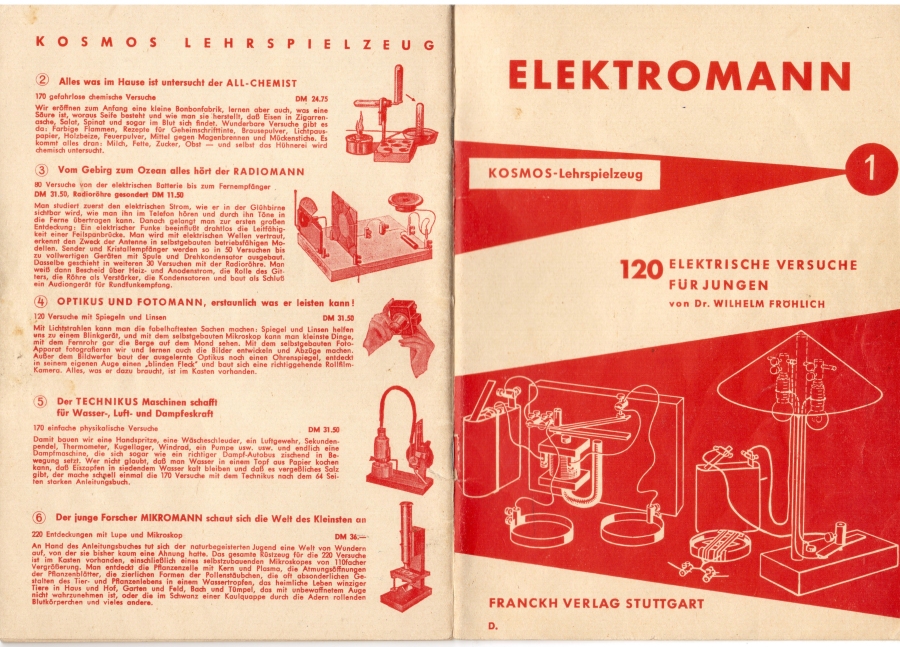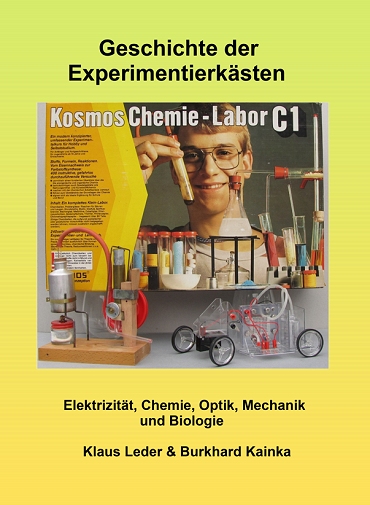Elektromann, ein Kosmos-Lehrspielzeug von 1959
Elektro-Experimentierkästen im Wandel der Zeit (4)
von Klaus Leder
Im
Jahr 1959 wurde die 19. Auflage des Lehrspielzeugs „Elektromann“
von der Franckh'schen Verlagshandlung angeboten. Die Ausstattung des
Kastens lässt erkennen, dass die Mängel der Nachkriegszeit
überwunden sind: Der Kastendeckel wirbt für das Produkt mit einem
farbigen, großformatigen Foto eines Jungen, der seine selbstgebaute
elektrische Klingel mit einem Taster einschaltet.
Die
Materialien des Kastens sind verbessert worden. Es gibt drei
Grundbretter aus Buchenholz und die Klemmen sind nicht mehr aus einer
Zinklegierung sondern aus blinkendem Messing gefertigt.
In
der 48seitigen Anleitung werden 120 Versuche in einer die Schüler
ansprechenden Sprache beschrieben und durch zahlreiche, sorgfältig
ausgeführte perspektivische Strichzeichnungen dargestellt.
Die
Jungen und Mädchen, die damals mit Hilfe der selbstgebauten
Taschenlampe ihren Karl May unter der Bettdecke noch bis spät in die
Nacht hinein lesen konnten, hat der etwas altmodische Text des
Anleitungsheftes nicht gestört. Der Elektromann war ein sehr
erfolgreiches Lehrspielzeug, das weniger der physikalischen
Begriffsbildung verpflichtet war, dafür aber Freude und Begeisterung
bei den Jugendlichen erzeugte und ihnen ein Grundverständnis der
elektrischen und magnetischen Phänomene vermittelte.
Wilhelm
Fröhlich (1892-1969), der Erfinder der legendären
Kosmos-Experimentierkästen, veröffentlichte im Jahr 1953 in einer
Schrift der Franckh'schen Verlagshandlung den Artikel „Wie die
Kosmos-Baukästen entstanden“. Der schweizer Sekundarlehrer
Fröhlich schreibt:
„Meine
eigene Erfahrung als Schüler und meine späteren Beobachtungen als
Lehrer haben mir gezeigt, wie sehr gerade der 12-15jährige Schüler
nach solcher eigenen Experimentiertätigkeit hungert. Hatte ich doch
als Schüler nicht gerastet und geruht, bis ich Versuche, die
vielleicht in der Schule gezeigt wurden, oder im Lehrbuch erwähnt
waren, mit selbstgebastelten und oft sehr primitiven Apparaten selbst
ausgeführt hatte. Die dabei zu überwindenden Schwierigkeiten sind
mir noch heute lebhaft gegenwärtig. Es fehlte jedes geeignete
Material und vor allem eine ausreichende Anleitung zu den Versuchen.
Das alte Physikbuch war in seinen Andeutungen viel zu knapp und
missverständlich.“
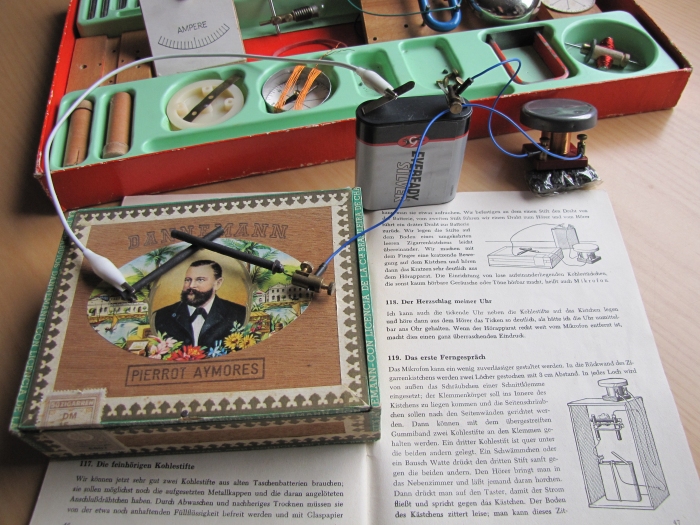
„An
mir selbst hatte ich es erfahren und an meinen Schülern konnte ich
es immer wieder beobachten, dass der Wunsch nach eigenen Experimenten
in einem 10- bis 15jährigen Jungen fast übermächtig wird. Er will
jetzt nichts mehr wissen von seiner Eisenbahn und nicht mehr mit
seinen Metallbaukästen Türme und Krane bauen, sondern er will
dahinter kommen, warum eine Taschenbatterie Strom liefert und wieso
sich der Hammer der elektrischen Glocke bewegt. Weil er die Grenze
seines Könnens noch nicht zu erkennen vermag, getraut sich der Junge
an die schwersten Probleme und will gleich eine Dynamomaschine, eine
Akkubatterie oder einen Funkeninduktor bauen. Das sind ausgerechnet
die Geräte, die dem Bastler nie gelingen und darum habe ich von
derartigen Bauvorhaben immer abgeraten.“
„Weil
dieser Experimentierdrang den 12- bis 15jährigen fast wie eine
Naturgewalt überfällt und später wieder verebbt, habe ich mir
vorgenommen, diese Experimentierfreude meinem Unterricht dienstbar zu
machen und den Schülern Gelegenheit zu eigenen Experimenten zu
geben.“
Fröhlich
wollte weggehen von einer sich nur an der Wandtafel abspielenden
"Kreidephysik" und der "Vorführphysik". Sein
didaktisches Ziel war die Selbstbetätigung
des
Schülers. Es war die Zeit der Reformpädagogik, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts u.a. von dem Münchner Pädagogen und Begründer
der „Arbeitsschule“ Georg Kerschensteiner (1854-1932) geprägt
wurde.
Fröhlich
berichtet in dem Artikel von einem Gespräch mit dem Leiter der
Lehrmittelabteilung des Kosmos-Verlags:
„Ich
machte geltend, dass für Schülerversuche die Apparate möglichst
einfach sein müssen und nannte einige Beispiele aus meiner
Unterrichtspraxis. Die Verlagsleiter interessierten sich lebhaft
dafür und erkannten, dass sie darin offenbar eine Arbeitsmethode
vorfanden, die dem entsprach, was sie schon lange gesucht hatten: sie
wollten ihren physikalisch interessierten Lesern eine Möglichkeit
verschaffen, Physik nicht nur zu lesen, sondern im eigenen Experiment
zu erleben. Sie ersuchten mich, die Geräte in einem handlichen
Kasten zu vereinen und ein methodisch geordnetes Lehrbuch dazu zu
schreiben.“
„So
entstand als erster der Kosmosbaukasten Elektrotechnik. Baukasten
hieß er deswegen, weil er keine fertigen Geräte enthielt, sondern
nur Teile zu vielseitigem Zusammenbau. Er war eigentlich mehr für
die häusliche Beschäftigung von Leuten gedacht, die in ihrer
Schulzeit keinen richtigen experimentellen Unterricht genossen
hatten.“
Der
Werbetext der Franckh'schen Verlagshandlung für den Elektromann von
1959 spiegelt etwas von der Lebenswelt der damaligen
Schülergeneration wider:
„Alles
baut Elektromann, was man mit Strom betreiben kann!
Spulen,
Drähte und Magnete sind beliebte Schätze in den Hosentaschen
aufgeweckter Jungen. Der kleine Elektromann hat noch viel feinere
Sachen wohlgeordnet in einem prächtigen Kasten. Besonders wertvoll
ist sein Anleitungsbuch, das in munterer Weise erzählt, wie man 120
elektrische Experimente mit den vielen Teilen ohne irgendwelche
Werkzeuge machen kann. Zum Beispiel eine selbstgebaute elektrische
Klingel, mit der uns Mutter morgens von der Küche aus wecken kann,
oder ein Geheimschloss für unsere Schublade oder einen Meldeapparat,
der uns anzeigt, wenn jemand in unserem Zimmer war. Große Freude
bereitet der Elektromagnet, mit dem wir einen Lastenheber, ein
Kraftwerk, ein Telefon und einen Elektromotor bauen können.
Was
werden eure Freunde staunen, wenn ihr eine selbstgebaute
Signalanlage, einen Kompass, eine Alarmanlage oder gar ein
Telegraphiergerät vorführt.“
Von
technisch interessierten Mädchen, die heute bessere Physiknoten
erzielen und im Studium oft erfolgreicher sind als männliche
Studierende, war damals noch nicht die Rede.
Aufgrund
seiner Empathie für Jugendliche und seiner exzellenten
naturwissenschaftlichen Kenntnisse gelang es dem Sekundarlehrer
Fröhlich, Experimentierkästen zu konzipieren und
Versuchsanleitungen zu schreiben, die über einen Zeitraum von mehr
als vierzig Jahren erfolgreich waren. Die Universität Bern verlieh
1957 Wilhelm Fröhlich für die Entwicklung dieser
Experimentierkästen den Ehrendoktortitel. 1966 erhielt er die
„Wilhelm-Boelsche-Medaille“ des Kosmos-Verlags.
s. a.
Märklin ELEX 503: Experimentierkasten der Oberklasse von 1932
Elektro-Experimentierkästen im Wandel der Zeit (1)
Experimentirkasten A. der Ernst Plank KG, Nürnberg 1866
Elektro-Experimentierkästen im Wandel der Zeit (2)
EFIX-Studio, ein Experimentierkasten der 1950er Jahre
Elektro-Experimentierkästen im Wandel der Zeit (3)